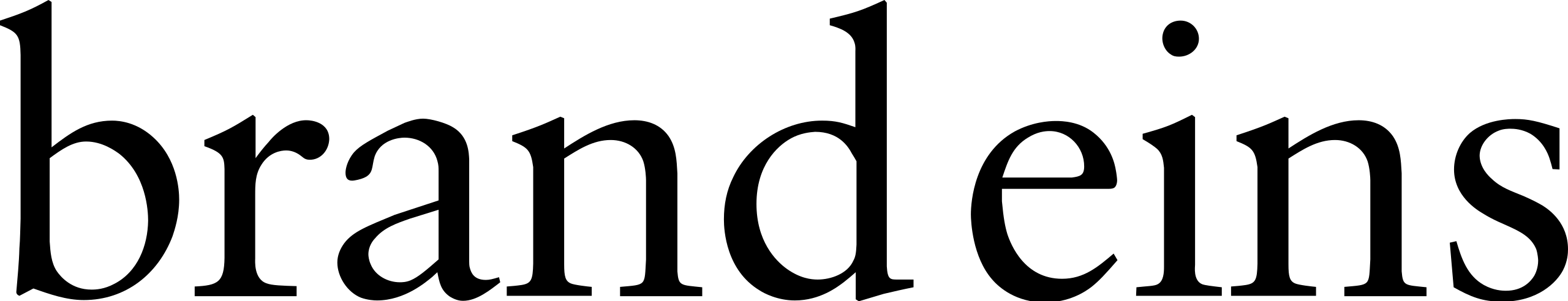Inneres Team & Seitenmodell
Die Arbeit mit dem „inneren Team“ bzw. mit den „inneren Seiten“ (Stimmen, Figuren etc.) – Anmerkung: in der Folge wird alternierend einer dieser Begriffe verwendet, gemeint sind immer alle – basiert auf dem Konzept bzw. der Annahme, dass wir nicht „Eine/r“, sondern „Viele“ sind, sprich einerseits unterschiedliche innere Strebungen besitzen, andererseits darüber hinaus sogar unterschiedliche „Teilpersönlichkeiten“ zeigen, welche kontextabhängig mehr oder weniger stark in den Vordergrund treten.
Neurophysiologische Untersuchungen legen die Vermutung nahe, dass dies tatsächlich mit einer Aktivierung unterschiedlicher „neuronaler Netze“ einhergeht, welche in jeweils verschiedenen Kontexten verstärkt aktiv sind und folglich unterschiedliche Charakterstrukturen, Haltungen etc. ausagieren lassen.
Diese „re-aktivierten“ Teilpersönlichkeiten werden z.T. als inadäquat, störend, unwillkürlich auftretend etc. empfunden. Dies hat meist damit zu tun, dass sie „aus einer anderen Zeit“ stammen, etwa aus Kindheit und Jugend, wo sie das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Handlungs- und Lösungsrepertoire abgebildet haben, jedoch noch nicht die Lebenserfahrung und Lösungskompetenz der erwachsenen Person, die im „Hier und Jetzt“ neuerlich damit konfrontiert ist. Der Kontext dient meist als „Trigger“ zur Aktivierung dieser (alten bzw. „eingefrorenen“) Teilpersönlichkeit, welche dann dominant in den Vordergrund tritt und erwachsenere Anteile in den Hintergrund drängt.
Im Rahmen der Arbeit mit diesen Seiten gilt es im ersten Schritt, jene zu identifizieren, die im „Problem-Zustand“ aktiv sind. Dabei handelt es sich oft um mehrere Anteile, die gerne innere Allianzen bilden oder aber auch innere Kämpfe austragen. Im Coaching werden hilfreiche, adäquatere Anteile gesucht (meist ebenfalls bereits vorhanden) und vor allem eine sog. „Steuerinstanz“ (ein Dirigent, innerer Chef etc.) identifiziert, oder – falls nicht existent – kreiert und implementiert. Ziel ist, dass es den Coachees gelingt, in Zukunft im selben Kontext die hilfreichen, adäquaten Anteile im Vordergrund zu halten (oder möglichst rasch re-aktivieren zu können) und damit den Zugriff auf eigene Kompetenzen und Ressourcen sicher zu stellen – was wiederum eine optimale Lebens- bzw. Arbeitsbewältigung sichern hilft.
Wichtig zu betonen ist, dass ausnahmslos „alle Teile“ das Beste für die Person wollen – dieses „Beste“ jedoch manchmal nicht (mehr) zu der aktuellen Situation passt, sprich entsprechende Ressourcen oder Kompetenzen nicht (noch nicht/nicht mehr) stimmig und zieldienlich sind. Viele Coachees haben daher die Fantasie, diese „wegmachen“ zu wollen, zu eliminieren. Ein solches Anliegen ist zwar emotional nachvollziehbar und verständlich – vor allem bei Situationen, die als besonders quälend oder inadäquat usw. wahrgenommen werden – führt jedoch bei den meisten Coachees dazu, dass gerade diese „verdrängten“ Anteile mit aller Macht „am Leben bleiben“ wollen und sich zu unpassender Zeit in den Vordergrund drängen!
Die Quellen für diese Arbeit gehen weit zurück. So lassen sich bereits in uralten schamanistischen Praktiken erste Ansätze der Teilearbeit entdecken, finden sich aber auch im christlichen und generell religiösen Kontext häufig wieder (z.B. bei der Besessenheit von (meist) „bösen Geistern“, die dann im Rahmen exorzistischer Praktiken „ausgetrieben“ wurden). Modernere Quellen gehen zurück auf Morenos soziometrische Arbeit und das Psychodrama, aber auch auf Bernes Transaktionsanalyse oder die Ego-State-Therapy nach Watkins & Watkins. Im deutschen Sprachraum hat vor allem Schulz v. Thun das „innere Team“ als Begriff bekannt gemacht und auch die systemische Aufstellungsarbeit (gleich ob von Hellinger oder auch Varga von Kibed / Insa Sparrer) arbeitet unter ähnlichen Prämissen.
Zeitaufwand
Der Zeitaufwand ist abhängig von Umfang und Komplexität der Fragestellung sowie den sich in den Coachees „vorstellenden“ Seiten. In manchen Fällen kann bereits innerhalb einer Coaching-Einheit erfolgreich das „Set an Seiten von Relevanz“ identifiziert werden und u.U. auch schon eine Verhandlung zwischen Teilen stattfinden oder eine Steuerinstanz reaktiviert und/oder implementiert werden. Häufig kann es zieldienlich und hilfreich sein, den Coachees auch eine „Aufgabe“ mit nach Hause zu geben, die explorierten Seiten noch detaillierter auszuarbeiten und/oder weitere relevante zu identifizieren. In der/den Folgesitzungen können wir dann meist Aushandlungsprozesse und hilfreiche Lösungsvarianten gemeinsam erarbeiten und verankern.
Material und räumliche Rahmenbedingungen
Abhängig von Vorlieben der Coachees: Mehrere Sessel in den Raum stellen, Blätter auflegen lassen, Figuren auf das Aufstellungsbrett stellen lassen, auf Block oder Flip zeichnen lassen etc. Sehr hilfreich ist es, die jeweiligen Kurzbeschreibungen der relevanten Teammitglieder jeweils auf getrennten Blättern/Karten zu erfassen und räumlich anzuordnen – nach z.B. Zugehörigkeit, Nähe – Distanz, Position zum Thema usw., wobei die Positionierung strikt durch die Coachees erfolgen soll und auf Stimmigkeit zu überprüfen und auch jederzeit nachjustierbar ist, da sich im Laufe des Prozesses auch „Neu-Konstellationen“ herausbilden können, die für die Coachees „stimmiger“ erscheinen.
Die Arbeit mit dem „inneren Team“, mit Seiten und/oder Teilpersönlichkeiten bietet sich immer dann an, wenn Coachees Signale von Ambivalenz im inneren Erleben und/oder in Bezug auf eine Frage- bzw. Problemstellung zeigen. Dies kann z.B. bei Entscheidungsthemen der Fall sein (etwa: weiterer beruflicher Weg, Entscheidung zwischen verschiedenen Handlungsoptionen, …) oder inneren wie äußeren Konflikten (z.B. Reaktion auf bestimmte Situationen, auf Vorgesetzte und/oder Kolleginnen und Kollegen und deren Ansprüche oder Forderungen etc.) u.v.m.
Diese Methode ermöglicht es den Coachees, unterschiedliche Strebungen, Ambivalenzen, konkurrierende Bewertungen etc. erstens überhaupt als solche wahrzunehmen, zweitens konkret zu explorieren und zu benennen (und damit zu externalisieren, was aus Selbstanklage und Selbstabwertung führen hilft) und drittens damit auch von übermächtigen Generalisierungen weg zu kommen i.S.v. „Nicht ich als Gesamtes ‚BIN SO‘, sondern lediglich ‚EIN TEIL VON MIR‘ zeigt bestimmte Eigenschaften, Verhaltensweisen, Tendenzen usw.“ Dies hat einen kathartischen Effekt und zeigt den Coachees auch, dass sie nicht „monolithische Wesen“ sind, sondern vielmehr ein Team von mehreren Teilpersönlichkeiten mit unterschiedlichen Strebungen, die jedoch auch stimmig „im Konzert“ agieren können. Die Exploration der Teilpersönlichkeiten, aber vor allem die Etablierung einer Steuerinstanz sowie die zieldienliche Lösungsarbeit wirken entlastend und ressourcenorientiert, da die Coachees erkennen können, dass es in ihnen auch viele konstruktive, kompetente bzw. adäquate Anteile gibt, deren Existenz sich ihnen jedoch in den als problematisch beschriebenen Kontexten entzieht. Diese können jedoch mit geeigneten Mitteln und Methoden auch jederzeit wieder reaktiviert werden und somit die Coachees wieder in die „Gestalter-Rolle“ bringen, was generell eines der Hauptanliegen von Coaching sein sollte.
Schritt 1: Exploration & Identifizierung
Wenn eine Coachee z.B. mit einer Entscheidungsproblematik bzw. hoher Ambivalenz ins Coaching kommt, dann ist es sinnvoll, wenn wir beim Einsatz der Methode (wie aus meiner Sicht bei allen Methoden, die man Coachees anbietet), zuerst eine grundsätzliche Erläuterung geben. Hierbei ist es meist hilfreich, die Coachee einzuladen (z.B. im Zuge eines Experiments), sich vorerst einmal der konkreten ambivalenten Strebungen klar zu werden. Diese werden oft als verwirrend und diffus beschrieben. Jene Personen, die von sich aus bereits Formulierungen wählen, wie: „Da gibt es so eine Stimme in mir, die mich auf diese Seite zieht… und eine andere, die immer dann lauter wird, wenn ich mich dort hin bewege…“, wenden implizit das Konzept des inneren Teams bereits an, dies jedoch in aller Regel nicht systematisch und/oder in strukturierter Form. Sobald Coachees diesen widerstrebenden Anteilen auch nur annähernd eine Stimme, eine Figur oder Haltung geben können, „greift“ das Konzept und es gelingt ihnen meist spontan, diese detailgetreuer zu beschreiben. Im Rahmen der Exploration der unterschiedlichen Anteile ist es zweckdienlich, diese möglichst ausführlich zu „externalisieren“, also z.B. auf Moderationskarten (nicht zu klein) in möglichst konkreten Parametern zu beschreiben: treffende Kurzbezeichnung („Die Zögerliche“, „Der Jammerer“ o.ä.), gefühltes Alter, Größe, (gibt oft über weit zurück liegende Anteile Auskunft), Geschlecht (muss nicht dem tatsächlichen entsprechen), typische Haltung und dazu passende Aussagen (wie z.B.: „Eh klar, dass mir das immer passiert!“, „Bei mir wird sicherlich nicht aufgegeben!“ etc.), Aussehen, Kleidung, Mimik, Körperhaltung und Tonus, Grundstimmung, Emotionen und Gefühle etc. Hier sind vor allem jene Informationen hilfreich, welche für die Coachees von Bedeutung sind und von ihnen spontan benannt werden – es erfordert ein gewisses Fingerspitzengefühl, einerseits die Coachees zu einer ausreichend detaillierten Beschreibung zu bewegen, andererseits dies nicht zu übertreiben, um inneren Widerstand oder auch ein Gefühl mangelnder Kompetenz bei den Coachees zu vermeiden, vor allem bei jenen Personen, denen es spontan nicht so leicht fällt, ihre inneren Wahrnehmungen entsprechend zu artikulieren.
Schritt 2: Positionierung zueinander
Wenn die ersten und wichtigsten Teammitglieder „herausgearbeitet“ worden sind (es können spontan weitere auftauchen), werden diese im Raum positioniert und zueinander in Beziehung gesetzt. Hier gilt es, gemeinsam mit den Coachees ein Gefühl der „Stimmigkeit“ – des „felt sense“ (im Sinne von E. Gendlin) – zu finden. Dabei werden die ausgearbeiteten Moderationskarten (im Idealfall mit unterschiedlichen Formen und/oder Farben) auf den Boden gelegt und die Coachees stellen sich darauf (oder auch davor/dahinter), wählen die Blickrichtung, nehmen auch die dazu passende Körperhaltung etc. ein und schlüpfen in die jeweilige „Rolle“. Die unterschiedlichen Mitglieder werden im Laufe des Prozesses Schritt für Schritt konkreter (und auch mit entsprechender „Nachjustierung“) in immer stimmigere „Beziehung“ zueinander gesetzt. Hierbei zeigen sich in aller Regel bereits erste „Aktions-Reaktions-Muster“ bei den Coachees, die dann u.U. spontan „aus ihnen hervorbrechen“ mit Aussagen wie z.B.: „Na, wenn ich die sowas sagen höre, dann bekomm‘ ich eine derartige Wut …“ usw.
Schritt 3: Finden und Etablieren einer Steuerinstanz
So sich bei der Exploration und Identifizierung keine Seite gefunden hat, die als „Steuerinstanz“ in Frage kommt, gilt es konkret nach einer solchen zu suchen bzw. diese konkret „herauszuarbeiten“. Wieso das? Kurz gesagt, weil dies eine außerordentliche hilfreiche „Konstruktion“ ist, die für die Coachees von Vorteil sein kann. Diese Steuerinstanz übernimmt eine moderierende, sachliche, neutrale und/oder allparteiliche Position mit konkretem „Führungsanspruch im individuellen Lebens-Cockpit“, sie lässt sich weder zu abwertenden, destruktiv-aggressiven Haltungen verführen, noch zu unterwürfigen, selbst-abwertenden oder ängstlich-vermeidenden usw. Die Steuerinstanz hat meist – mit dem Transaktionsanalytischen Modell gesprochen – eine Erwachsenen-Position inne und erlaubt es den Coachees, zwischen den anderen widerstrebenden Anteilen zu vermitteln, auszuhandeln und/oder auch klare Entscheidungen zu treffen und diese in Folge umzusetzen.
Wenn Coachees anfangs Schwierigkeiten haben sollten, eine solche Steuerinstanz zu beschreiben, dann können wir als Coaches unterstützend intervenieren, indem wir die Coachees ersuchen, Personen aus dem eigenen Leben, Bekannten- oder Verwandtenkreis oder auch aus Literatur, Film, Fernsehen usw. zu „imaginieren“, denen sie diese genannten Eigenschaften als „Idealtypus“ zuschreiben. Werden diese dann im Detail beschrieben und die Coachees auch ersucht, deren Haltung, Position etc. einzunehmen – in Form eines „Als-ob-Konstruktes“ auszuagieren, kann diese als „Role-Model“ übernommen und somit auch als „neu implementiertes“ Teammitglied auf- und angenommen werden. Auch und gerade bei dieser Instanz sollte ausreichend Zeit und Sorgfalt aufgewendet werden, da die Steuerinstanz in Zukunft eine nachhaltige Rolle spielen soll – insofern sollten sich die Coachees mit dieser in hohem Maße identifizieren können.
Schritt 4: Verhandlung im Team und Lösungsvarianten
Sind alle relevanten Teammitglieder inkl. Steuerinstanz identifiziert und positioniert, wird auf die spezifische Frage- bzw. Problemstellung Bezug genommen – die ja Ausgangspunkt der Intervention war.
Nachdem alle Teile dazu Stellung genommen haben, somit die einzelnen Positionen weitgehend klar geworden sind, werden diese auch zu ihren jeweiligen Ideen, Wünschen und Bedürfnissen im Sinne einer Lösung befragt:
- Wie sähe/n aus Deiner Sicht die ideale/n Lösung/en aus?
- Wie stehst Du zu den Wünschen, Bedürfnissen der anderen Seite/n?
- Kannst Du diese nachvollziehen/verstehen?
- Welche Gefühle bzw. Emotionen lösen diese bei Dir aus?
- Was brauchst Du, um Dich auf die andere/n Seite/n einen Schritt zubewegen zu können?
- Gibt es Dinge, die unverzichtbar für Dich sind?
- Welche Konsequenzen hätte/n diese Lösungsvariante/n für Dich/für andere?
- Kannst/willst Du mit diesen Konsequenzen (auch) leben?
- usf.
Ziel dieser Intervention ist es, möglichst allen Seiten, „subjektiven Wahrheiten“, Wünschen und Bedürfnissen mit all ihren unterschiedlichen Konsequenzen Raum zu geben, diese in die richtige Dimension zueinander zu setzen, zu gewichten, ihnen „nachzuspüren“ und im Idealfall einige wenige zieldienliche und adäquate Lösungsvarianten mit hoher Akzeptanz herauszuarbeiten, sodass eine möglichst hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit die Folge ist.
Schritt 5: Commitment aller Teammitglieder/Teile/Seiten und Wertschätzung
Um das Commitment aller Teile zu erhalten ist es wichtig, diese ausnahmslos wertzuschätzen. Was ist damit gemeint? Gerade jene Seiten, deren Verhalten bzw. Haltung als inadäquat, problematisch oder unerwünscht beschrieben und wahrgenommen werden, haben in aller Regel auch Bedürfnisse und Wünsche, die nicht immer dem „Ideal“ der Coachees entsprechen. Diese „wegzumachen“ macht keinen Sinn, sind sie doch wertzuschätzende Haltungen, Wünsche und Bedürfnisse, die subjektiv Berechtigung haben – vielleicht nicht heute –, denn sie sind Ausdruck eines inneren Anteils, der zum Besten der Person agieren möchte. Wir als Coaches können den Coachees hier hilfreiche Metaphern anbieten, wie z.B. jene der „Warnleuchte im Auto“, bei welcher auch niemand auf die Idee käme, diese beim Aufleuchten zu zerschlagen und munter weiter zu fahren, sondern sie als Hinweis auf eine Störung im „Gesamtsystem Auto“ versteht. Insofern ist es zieldienlich, wenn Coachees jene spontan und unwillkürlich auftretenden Stimmen als „Wink“ verstehen, ihnen den entsprechenden Raum gewähren, sich innerlich bei ihnen bedanken und dann – mittels Steuerinstanz – die jeweilige Situation darauf hin überprüfen, welche Seite aktuell stärker im Vordergrund stehen sollte, weil dies dem Kontext besser entspricht, bessere bzw. adäquatere Ergebnisse erzielen hilft usw.
Schritt 6: Überprüfung, Probehandeln, Nachjustieren
Alle im Coaching erzielten Ergebnisse sind für Coachees nur dann wirklich hilfreich, wenn es gelingt, diese auch in den Alltag (beruflich wie privat) zu transferieren. Aus diesem Grunde braucht es u.U. ein Probehandeln – im Idealfall in niederschwelligen Situationen, bei welchen keine gravierenden Folgen zu befürchten sind. Hierbei ist es wichtig, mit ersten kleinen Schritten („Baby-Steps“) zu beginnen und sich nicht gleich zu viel vorzunehmen und/oder zu erwarten, dass „alte Muster“ von heute auf morgen verschwunden sein werden. In günstigen Fällen mag dies durchaus der Fall sein, in Stresssituationen neigen wir jedoch generell dazu, auf „alterprobte Muster und Verhaltensweisen“ zurückzugreifen – wider besseren Wissens!
Auch sog. „Rückfälle“ (diesen Begriff sollte man tunlichst vermeiden!) sollten Coachees neu und anders interpretieren lernen, nämlich in ressourcenorientiertem Sinne. Überzogene „Vornahmen“ oder gar „Versprechen“ (von Seiten der Coaches ein absolutes „No-Go“!) sind in keinerlei Weise hilfreich, da sie die Gefahr des Scheiterns (die es immer auch gibt) ausblenden. Stattdessen sollten wir darauf verweisen, dass es vorkommen kann, dass nicht immer alles sofort, oder in vollem Umfang gelingen muss, sondern jede noch so kleine „positive/gewollte Veränderung als „erster Schritt in die gewünschte Richtung“ interpretiert werden kann – was einer positiven Rückkoppelung entspricht (einem „Schneeball-Effekt“).
Wenn die Coachees erste Erfahrungen machen konnten, sollten diese gemeinsam reflektiert und analysiert werden:
- Was hat funktioniert? Das beibehalten bzw. mehr davon tun.
- Was hat nur zum Teil funktioniert? Hier sollten alle relevanten Faktoren betrachtet werden, die eine Rolle gespielt haben können. Kleinere „Nachjustierungen“ können das Ergebnis jedoch maßgeblich verbessern.
- Was hat nicht funktioniert? Hier sind vor allem die Hypothesen der Coachees von Interesse, denn diese können auch ein Hinweis darauf sein, dass etwaige Vornahmen oder „Verhandlungsergebnisse“ des inneren Teams nicht wirklich das Commitment aller Mitglieder hatte – oder, dass maßgebliche Teile sich noch nicht „gezeigt“ haben und die Umsetzung „boykottieren“.
- Was kann als Nächstes/Zusätzliches/Neues getan werden?
Schlüsselsequenzen (inkl. Fallen, besondere Chancen, Erfolgsfaktoren)
- Tempo: Immer am Tempo der Coachees orientieren, diese weder überfahren noch ausbremsen, andererseits jedoch darauf achten, dass Coachees sich nicht zu ausführlich mit weniger relevanten Aspekten beschäftigen und/oder lediglich an der Oberfläche bleiben – dies könnten auch Hinweise auf Vermeidungsstrategien sein.
- Ratschläge vs. Angebote: Wir sollten keine Ratschläge geben, sondern vielmehr den Coachees dabei helfen, über Prozessinterventionen eigene Lösungen zu finden, da diese in aller Regel eher umgesetzt werden, als solche von außen. Dies heißt jedoch nicht, dass wir als Coaches mit allen Lösungsideen hintan halten sollten, so wir z.B. bemerken, dass Coachees sich schwer tun Lösungsideen zu finden – in solchen Fällen kann es hilfreich sein, ein „Menü an potentiellen Lösungsvarianten“ anzubieten i.S.e. „Realitätenkellners“, immer jedoch mit dem Hinweis, dass dies nur „mögliche Lösungsvarianten“ sind, nicht „Wahrheiten“ oder „Rezepte“, die mit Garantie zum Erfolg führen werden.
- Nur nichts „wegmachen“! Wie schon mehrfach beschrieben, sollte kein Teil „weggemacht“ oder „vertrieben“ werden. Ausnahmslos jeder erfüllt einen Zweck im Sinne der Coachees – wenn nicht heute, so vielleicht in der Vergangenheit oder aber auch wieder einmal in der Zukunft. Insofern stellt jeder dieser Anteile eine „Ressource“ und „Kompetenz“ dar, die auch im Sinne der Coachees genutzt werden kann – aber eben zur rechten Zeit und am rechten Ort – und dieser adäquate Einsatz sollte durch die Steuerinstanz der Coachees im Zweifel koordiniert werden können.